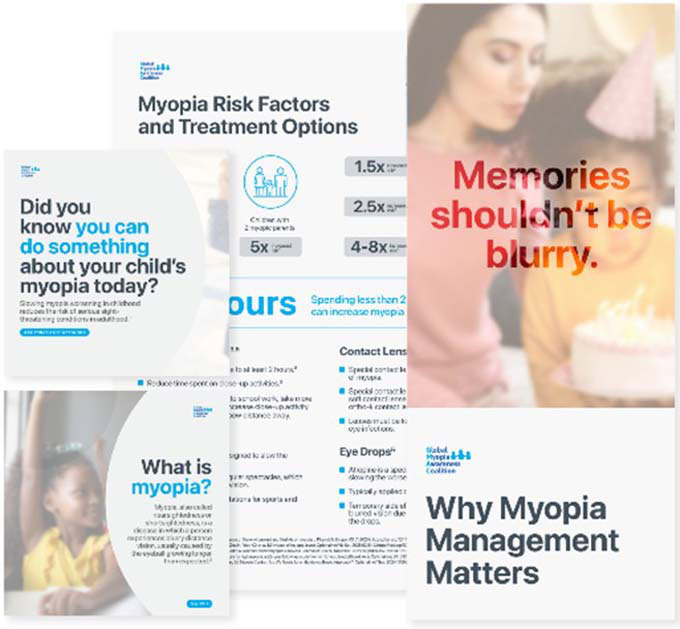Die Anzahl der Praxen und Geschäfte in der Schweiz mit Schwerpunkt Binokularsehen verdoppelt
Die optometrische Versorgung von Menschen mit Binokularproblemen zu verbessern, ist ein anspruchsvolles Ziel.

Zielsetzung
Im Idealfall wäre in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür vorhanden, dass man zur optometrischen Augenprüfung geht, wenn Sehbeschwerden zum Beispiel am Arbeitsplatz auftreten. Eltern würden wissen, an wen sie sich wenden können, wenn es bei ihren Schulkindern unerwartete Leseprobleme und sehbedingte Kopfschmerzen gibt. Die Realität sieht derzeit anders aus. Viele Betroffene wissen noch gar nicht, dass ihnen oder ihren Kindern möglicherweise geholfen werden kann. Oder sie halten ihre Probleme für normal und können sich nicht vorstellen, dass eine andere und bessere Seh-Qualität möglich wäre. Die Möglichkeiten der Optometrie, mittels Brillenkorrektion, Visualtraining oder Kontaktlinsen die Leistungen von Akkommodation und beidäugiger Zusammenarbeit zu unterstützen, um Sehstress zu reduzieren, haben sich noch nicht genügend herumgesprochen. Die hier angesprochenen Sehprobleme sind weder durch Erkrankungen, Allergien oder durch Strabismus bzw. Amblyopie verursacht, sondern treten bei 30 % aller Menschen mit gesunden Augen auf.
Selbst wenn die Optometrie schon vollständig als erste Anlaufadresse für Sehprobleme etabliert wäre, kommt eine weitere Herausforderung zum Tragen: Derzeit ist keine flächendeckende Versorgung mit Praxen oder Fachgeschäften in der Schweiz sichergestellt, die sich auf das Lösen von binokularen Problemen spezialisiert haben.
Somit ergeben sich zwei konkrete Aufgaben, die man nacheinander adressieren sollte:
- Die Anzahl an Schwerpunktpraxen und -Geschäften als Ansprechpartner für binokulare Probleme durch Aus- und Weiterbildungen vergrössern, damit in der Schweiz der Zugang zu einer guten Versorgung sichergestellt wird.
- Die Öffentlichkeit über die Häufigkeit von Sehproblemen bei Schulkindern (und Erwachsenen) informieren und für die Möglichkeiten der Optometrie sensibilisieren.
An der ersten Aufgabe wird bereits seit zwei Jahren gearbeitet, seitdem ein «Runder Tisch Binokularsehen» als Zoom-Treffen ins Leben gerufen wurde. Gleichzeitig ist ein regelmässiges Weiterbildungsangebot am Institut für Optometrie zu binokularen Themen eingerichtet worden, dass sich ab 2024 vor allem dem Thema BTSO widmet: www.btso.ch.
Die zweite Aufgabe ist nicht allein von einem Institut der FHNW zu lösen, sondern benötigt ein gutes Zusammenwirken vieler Berufs- und Weiterbildungsorganisationen im Bereich Augenoptik und Optometrie und darüber hinaus. Wenn es gelingt, eine gross angelegte Studie zur Ermittlung der Häufigkeiten von Sehstress bei Primar-Schulkindern in der Schweiz zu finanzieren, würde dies die Kontakte zu Schulen festigen und eine Kampagne zur Information der Öffentlichkeit vorbereiten. Weil das Wohlergehen der Schulkinder vielen Menschen am Herzen liegt, lassen sie sich sicherlich dafür begeistern.
Vorgeschichte
Im Jahr 2018 wurde unter Leitung von Prof. Roger Crelier und Prof. Dr. Stephanie Jainta ein Projekt begonnen, das die Ausbildung im Studiengang Optometrie voranbringen und darüber hinaus Reichweite für den Berufsstand in der Schweiz haben sollte. Unter anderem aufgrund der besonderen personellen Expertise am Institut für Optometrie in Olten wurde der Bereich des Binokularsehens für dieses Projekt ausgewählt. Im Team gab es eine beträchtliche Liste an Publikationen zu Themen wie Binokulares Eyetracking, Leseforschung und Anwendung von binokularen Methoden. Das Projekt unter dem Namen «Binokulare Testsequenz Olten» (BTSO) wurde von der Stiftung OptikSchweiz bis Anfang 2025 gefördert und hatte verschiedene Projektphasen. Die Ziele lauteten von Beginn an:
- Übersicht und Analyse bestehender Modellvorstellungen, die als Grundlage für eine neue, binokulare Testsequenz dienen.
- Herausarbeiten der entscheidenden binokularen Parameter im Dialog mit Ophthalmologie, Orthoptik und Optometrie/Augenoptik, auf denen die neue Sequenz basieren wird; dazu werden Workshops/Vorträge im IO organisiert und gezielt externe Experten aus den verschiedenen Berufsgruppen eingeladen, um das Team am Institut für Optometrie zu erweitern.
- Entwicklung entsprechender Mess- und Testanordnungen.
- Entwicklung einer verifizierten (evidence based) und sequenzierten Vorgehensweise zur Bestimmung des binokularen Status, mit der eine binokulare Korrektion oder Intervention festgelegt werden kann.
- Die Testformen und Vorgehensweisen werden klar, detailliert und nachvollziehbar beschrieben.
- Bei entsprechender Verwendung und Vorgehen kann die Nennung « … getestet gemäss BTSO … » verwendet werden.
- Eine systematische, multizentrische, klinische Erprobung des Verfahrens erfolgt im Anschluss.
Es fanden mehrere Treffen mit Fachleuten aus verschiedenen Berufsgruppen in den ersten Projektjahren statt, in denen ausgelotet wurde, wo es Überschneidungen und wo Ergänzungen gibt. Die Aussensicht war besonders wertvoll, um den eigenen Horizont zu erweitern. Besonders intensiv wurde die Literaturrecherche betrieben: In wöchentlichen Treffen des damals sechsköpfigen Teams am Institut wurden Erkenntnisse gesammelt und geteilt. Das Fachbuch «Perceiving in depth» (HOWARD, 2012) stand ein ganzes Jahr lang im Mittelpunkt. Danach wurde die Recherche auf die aktuelle Studienlage ausgedehnt. Mit dem Werk «Clinical Management of Binocular Vision» (SCHEIMAN; WICK, 2020) war ein weiteres Fachbuch für die gesamte Projektzeit ein wichtiger Ratgeber. Von den Inhalten dieses Buches sind die Ausbildungen und klinische Praxis in der Optometrie weltweit auf allen Kontinenten beeinflusst.
Im zweiten und dritten Projektjahr wurde die Machbarkeit eines objektiven Messgerätes für kleinste bis grosse Augenbewegungen mittels SLO (Laser Scanning Opthalmoskop) untersucht. In Zusammenarbeit mit dem «Labor für Entwicklung von Lasern und optischen Systemen FHNW» in Windisch und führenden Experten in Bonn und Erlangen (Deutschland) wurde ein Modell-Aufbau realisiert, mit dem auch Strukturen im Zentrum der Netzhaut sichtbar gemacht werden können. Am Ende 2021 wurden wichtige Erkenntnisse zur prinzipiellen Machbarkeit generiert, die grösste Herausforderung bestand aber in der stabilen, binokularen Zentrierung der Patientenaugen. Es wäre zwar technisch möglich, dass Patient:innen Vorschaltgläser oder Brillengläser bei einer Messung tragen, aber der exakte Einblick-Ort müsste äusserst genau eingehalten werden. In der praktischen Nutzung wäre es somit notwendig, die Patient:innen vor dem Gerät so stark zu fixieren, dass selbst kleinste Bewegungen des Kopfes unmöglich gemacht werden. Letztlich wurde aufgrund der zu erwartenden, hohen Entwicklungs-Kosten dieser Weg der Entwicklung einer objektiven Messsequenz verlassen.
Entwicklung einer Lern-App
Ab 2021 wurden dann die vorliegenden Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengefasst und neu bewertet. Dies war der eigentliche Beginn der inzwischen bekannten BTSO-Testsequenz. Neben anderen Publikationen kam der massgebliche Impuls aus einer Studienserie, die unter dem Namen «BAND 1–3» (HUSSAINDEEN 2017–2018) publiziert wurde. Von Beginn an sollte hier eine einfache und kostengünstige Testbatterie für akkommodative und binokulare Auffälligkeiten entwickelt werden. Dafür wurden die vollständigen Normwerte der wichtigsten Messungen in BAND 1 ermittelt, bestehend aus fünf akkommodativen und elf binokularen Tests. 920 Schulkinder in Süd-Indien im Alter zwischen 6 und 17 Jahren wurden untersucht, zur Hälfte aus städtischer und ländlicher Umgebung. In BAND 2 wurde analysiert, wie häufig und in welcher Verteilung nicht strabismischen Klassen vorkommen (HUSSAINDEEN; RAKSHIT; et al., 2017). Die dort verwendete Klassifizierung war eng angelehnt an die etablierte «Integrative Analyse» von Scheiman und Wick. Bei 30 % der untersuchten Kinder (n=283) wurden Auffälligkeiten festgestellt. Die minimale Testbatterie ist das Ergebnis der Analysen der BAND 3 Studie (HUSSAINDEEN; RAKSHIT et al., 2018). Dazu wurde die Treffsicherheit von Einzeltests und auch von Test-Kombinationen untersucht. Ziel war es, den effektivsten Test beziehungsweise die effektivste Testbatterie zu ermitteln. Optimiert wurde diese Testbatterie für die am häufigsten vorkommenden Klassen: der Konvergenzinsuffizienz und der Akkommodations-Inflexibilität.
Aufbauend auf diese Studien wurde der Weg für BTSO neu angedacht. Ein Vorteil dieser minimalen Testbatterie liegt darin, dass sie für Screenings sowohl durch Fachleute als auch durch optometrische Laien verwendet werden kann. Wenn ein Schulkind oder ein Erwachsener im Screening auffällig testet, ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine akkommodative oder binokulare Auffälligkeit vorhanden. Dieses Resultat würde dann zu einer Überweisung für eine differenzierte, optometrische Untersuchung führen.
Die wenigen Tests der minimalen Testbatterie liefern ausserdem einen wichtigen Beitrag zu den Daten, mit denen der binokulare Status ermittelt wird. Die 9 wichtigsten binokularen und akkommodativen Klassen sind: Konvergenz- und Divergenzinsuffizienz, Konvergenz- und Divergenzexzess, Basis Eso- und Exophorie, Akkommodations-Insuffizienz, -Exzess und Unflexibilität. Für ihre Statusbestimmung wird üblicherweise aus der Datenfülle eine Gruppierung vorgenommen. Es gibt Hauptzeichen, die immer vorhanden sein müssen und Nebenzeichen, die den Befund abstützen müssen. In allen 9 Klassen gehören die Testdaten der minimalen Tests zu den Hauptzeichen. So wurde im BTSO-Team die Frage aufgeworfen, ob mit der minimalen Testbatterie nicht nur wenige Klassen gescreent werden können, sondern ob alle wichtigen 9 Klassen damit im Screening gefunden werden könnten. Eine spannende Entwicklungsphase begann, in der eine Entscheidungslogik entwickelt wurde, um damit eine App programmieren zu können. Ein externer Partner aus dem Bereich der Softwareentwicklung wurde gefunden, um von Beginn an eine professionelle Lösung anzustreben. Die anschliessende Entwicklung einer webbasierten Lern-App hat eine der wichtigsten Voraussetzungen geschaffen, um das erste Ziel anzugehen: Fachpersonen den Einstieg oder Wiedereinstieg in die Welt des Binokularsehens zu erleichtern und damit die Versorgungssituation in der Schweiz verbessern zu können. Wie wichtig es ist, ein Hilfsmittel anzubieten, wenn noch Unsicherheiten in der Thematik bestehen, stellte sich in einer Studierendenbefragung im Abschluss-Semester heraus. Selbst wenn eine Fachperson gut ausgebildet in die Praxis geht, braucht sie idealerweise ein Umfeld, in dem binokulare Abklärungen bereits etabliert sind. Oft ist dies nicht der Fall und es wurde mehrfach geäussert, dass ohne praktische Hilfestellung eine zu grosse Unsicherheit besteht, um auf sich selbst gestellt in diesem Bereich zu arbeiten.
Zum Herbstsemester 2023 wurde die BTSO Lern-App am Institut für Optometrie im Modul «Binokularsehen 1» eingeführt. Alle Studierenden erhalten dort freien Zugang zur Lern-App und können die Tests und Auswertungen auch im «Klinisch Optometrischen Praktikum» verwenden. Ein regelmässiges Weiterbildungsangebot für alle interessierten Fachpersonen mit dem Schwerpunkt der binokularen Analyse und Korrektion wurde am Institut eingerichtet. Mindestens der Besuch eines Weiterbildungskurses wurde als obligatorisch definiert, um die App freischalten zu können. Damit soll die fachliche Qualität der Anwendenden von BTSO sichergestellt werden. Ausserdem werden online Treffen zum Binokularsehen angeboten, zu denen regelmässig eingeladen wird. Auch wenn das Ziel einer flächendeckenden Versorgung noch längst nicht erreicht ist, zeichnen sich schöne Erfolge ab: So ist es gelungen, innerhalb eines Jahres die geschätzte Anzahl der Praxen und Geschäfte in der Schweiz mit Schwerpunkt Binokularsehen zu verdoppeln.

BTSO-Studien mit Erwachsenen
Teil der Projektziele war die Erforschung der neu definierten Testsequenz. Dazu wurden zwei multizentrische Studien (vier Zentren in der deutschsprachigen Schweiz) mit jeweils 150 Personen zwischen 18 und 38 Jahren durchgeführt, davon 100 mit Sehbeschwerden und 50 beschwerdefrei. Die Validierungsstudie vergleicht Ergebnisse der etablierten, vollständigen Analyse des binokularen Status mit denen der BTSO-Lern-App. Die Anamnesestudie sucht nach Übereinstimmungen zwischen den Fragen der neu entwickelten Anamnese und auffälligen Funktionsmessungen. Die Studien sind noch nicht fertiggestellt, aber alle Probandenmessungen wurden abgeschlossen. Der erforderliche Zeitaufwand hat sich als deutlich grösser herausgestellt, als es zu Beginn absehbar war. Aufgrund von Erkrankung im Team hat sich zusätzlich die Auswertung stark verzögert. Auch die Auswahl der Probanden war sehr anspruchsvoll, weil strenge Kriterien erfüllt werden mussten. Viele potenzielle Probanden mussten daher abgewiesen werden, weil die vorhandenen Korrektionswerte der aktuellen Brille nur geringfügig von den neu gemessenen Werten abweichen durften.
Hintergrund der Studie ist die bis heute verwendete Klassifizierung der Anomalien nicht strabismischen Binokularsehens, die A. Duane im Jahr 1896 vorgeschlagen (DUANE, 1896) und 1915 um die Akkommodationsklassen ergänzt hat (DUANE, 1915). Hohe Häufigkeiten von nicht strabismischer Anomalien werden in randomisierten Studien gefunden: 32 % bei Universitätsstudenten (GARCÍA-MUÑOZ; et al., 2016), 32 % bei erwachsenen Patienten einer Augenklinik (FRANCO et al., 2022) und 30 % bei Kindern und Jugendlichen in Süd-Indien (HUSSAINDEEN; RAKSHIT et al., 2017). Die Klassen zeigen an, ob die Probleme entweder durch binokulare Zusammenarbeit oder Akkommodation verursacht sind. Im Laufe der Zeit wurden diese Klassen weitgehend beibehalten und nur geringfügig erweitert, wie z. B. von Scheiman und Wick mit ihrer «Integrativen Analyse». Die Einteilung in 9 einzelne Klassen ermöglicht eine spezifische Intervention, wenn die Sehleistung trotz gesunder Augen vermindert ist und die täglichen Sehaufgaben zu subjektiven Beschwerden führen. Mögliche Interventionen wären dann beispielsweise Korrektionsbrillen mit Nahzusätzen und Prismen oder ein Visualtraining. Das Konzept wird jedoch auch in Frage gestellt, da Personen in jeder dieser Klassen auch beschwerdefrei sein können (CACHO-MARTÍNEZ; et al., 2014).
Unsere eigene Studie hat bei den 100 symptomatischen Probanden eine Häufigkeit der Anomalien von annähernd 17 % gefunden. Es gibt einige Herausforderungen, die wir bei der Auswertung festgestellt haben: Beim Übertragen der händisch auf Prüfprotokollen eingetragenen Messwerte in die Datentabelle können leicht Fehler entstehen. Um die Richtigkeit aller Daten sicherzustellen, haben wir unsere Daten zu verschiedenen Zeiten insgesamt dreifach geprüft. In der Auswertung gehen wir einen Weg, der in der Literatur noch nicht beschrieben worden ist: Wir erstellen eine Programmierung der Auswertelogik für die ausführliche Statusbestimmung, um manuelle Auswertefehler zu vermeiden. Die hierfür notwendigen Kriterien sind in einigen Studien recht gut beschrieben worden, aber nirgends vollständig. Daran lässt sich ablesen, dass in vergleichbaren Studien die Auswertelogik nicht bis zu Ende gedacht worden ist. Wenn man händisch auswertet, ist die klinische Erfahrung bei der Datengruppierung wichtig, um zu zuverlässigen Resultaten zu gelangen. Aber gleichzeitig besteht eine Fehleranfälligkeit, die kaum zu kalkulieren ist. Wir sind auf unsere Ergebnisse gespannt und werden versuchen, sie noch im Jahr 2025 fertigzustellen. Ganz sicher werden wir auch an dieser Stelle darüber berichten.
Geplante Entwicklungen
In der Arbeitsgruppe für Binokularsehen am Institut für Optometrie haben wir bereits einen ersten Plan ausgearbeitet, wie wir in einer gross angelegten Studie 700 Primar-Schulkinder auf binokulare und akkommodative Auffälligkeiten untersuchen können. Ein wichtiges Ziel ist es, die Häufigkeit von nicht strabismischen Sehproblemen bei Schulkindern in der Schweiz herauszufinden. Zudem können wir mit den Messungen aller wichtigen Sehfunktionen eigene Normwerte bestimmen und ähnlich wie in der Süd-Indischen Studie eine ganz spezifische Testbatterie berechnen. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind aus unserer Sicht eine notwendige Grundlage, um ein Screening auf nicht strabismische Besonderheiten an allen Primarschulen einzuführen. Wir würden damit den Weg vorbereiten, dass zunächst die Schulkinder mit Sehproblemen erkannt und anschliessend an die richtige Stelle zur Versorgung geschickt werden. Als nicht profitorientierte Forschungsinstitution ist das Institut für Optometrie ein glaubwürdiger Akteur. Das zu Beginn erwähnte Ziel der Information und Sensibilisierung der Schweizer Öffentlichkeit könnte damit um einen grossen Schritt vorangebracht werden. Insbesondere die häufig vorhandenen und selten erkannten Sehprobleme von Schulkindern würden eine besondere Beachtung erfahren. So werden mit der Zeit immer mehr Kinder von einer Korrektion ihrer nicht strabismischen Auffälligkeit profitieren. Die Erfahrungen von Frustration beim Lesen und vom Versagen wegen der vorhandenen Sehstörungen können vielen dieser Kinder erspart bleiben. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird niemand mehr nachvollziehen können, dass jahrzehntelang so wenig passiert ist, um diese Sehprobleme aufzudecken.
Die geplante Studie würde sich über zwei bis drei Jahre erstrecken und etwa 250 000 CHF kosten, der frühestmögliche Beginn könnte im Jahr 2026 sein. Eine Kooperation mit Fachleuten aus den Hochschulen für Pädagogik und der Gesundheitsforschung ist unabdingbar für ein solch grosses Projekt. Hilfreich werden die automatisierten Auswertungen der Erwachsenen-Studie sein, weil exakt die gleichen Messungen auch bei Kindern durchgeführt werden. Unsere Erfahrung mit optometrischen Messungen und dem Daten-Management sind weitere gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss dieser Studie. Für die Finanzierung sind Gespräche mit Stiftungen und mit den wichtigen Akteuren der Optometrie in der Schweiz geplant. Für mögliche Unterstützung, Anregungen und Fragen schreiben Sie gern an: volkhard.schroth@fhnw.ch.
Literatur:
CACHO-MARTÍNEZ, P.; GARCÍA-MUÑOZ, Á.; RUIZ-CANTERO, M. T. Is there any evidence for the validity of diagnostic criteria used for accommodative and nonstrabismic binocular dysfunctions? J Optom, 7, n. 1, p. 2–21, 2014 Jan-Mar 2014.
DUANE, A. A new classification of the motor anomalies of the eye: based upon physiological principles, together with their symptoms, diagnosis, and treatment. New York: Vail, J.H., 1896.
DUANE, A. Anomalies of the Accommodation Clinically Considered. Transactions of the American Ophthalmological Society, 14, n. Pt 1, 1915 1915.
FRANCO, S.; MOREIRA, A.; FERNANDES, A.; BAPTISTA, A. Accommodative and binocular vision dysfunctions in a Portuguese clinical population. Journal of Optometry, 15, n. 4, p. 271–277, 2022.
GARCÍA-MUÑOZ, Á.; CARBONELL-BONETE, S.; CANTÓ-CERDÁN, M.; CACHO-MARTÍNEZ, P. Accommodative and binocular dysfunctions: prevalence in a randomised sample of university students. Clinical & experimental optometry, 99, n. 4, 2016 Jul 2016.
HOWARD, I. P. Perceiving in Depth, Volume 1: Basic Mechanisms. New York: Oxford University Press, USA, 2012. 9780199764143.
HUSSAINDEEN, J. R.; RAKSHIT, A.; SINGH, N. K.; GEORGE, R. et al. Prevalence of non-strabismic anomalies of binocular vision in Tamil Nadu: report 2 of BAND study. Clin Exp Optom, 100, n. 6, p. 642–648, Nov 2017.
HUSSAINDEEN, J. R.; RAKSHIT, A.; SINGH, N. K.; SWAMINATHAN, M. et al. The minimum test battery to screen for binocular vision anomalies: report 3 of the BAND study. Clin Exp Optom, 101, n. 2, p. 281–287, Mar 2018.
HUSSAINDEEN, J. R. G., R; Swaminathan, M; et al. Binocular vision anomalies and normative data (BAND) in Tamil Nadu – study design and methods. Vis Dev Rehabil, 1, p. 260–271, 2015.
MAN, M.; WICK, B. Clinical Management of Binocular Vision. Philadelphia: Wolters Kluwer. Lippincott Williams & Williams, 2020. 9781496399755.