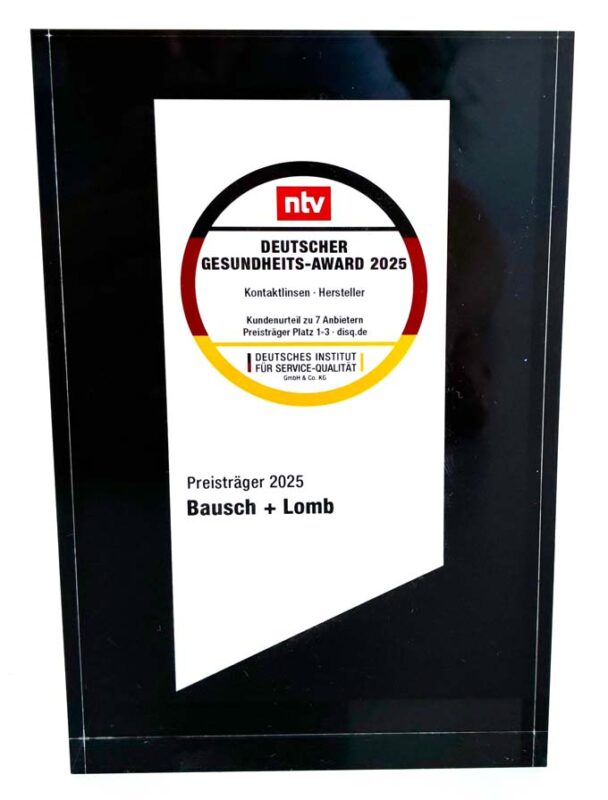Die Zukunft der Kontaktlinse – wenn Sehhilfen zu smarten Sensoren werden
Ein Abend mit Prof. Lyndon Jones zeigte, wie Kontaktlinsen schon bald Krankheiten erkennen, Medikamente abgeben und sogar wertvolle Informationen direkt ins Auge projizieren könnten.

Bis auf den letzten Platz besetzt, erhielt das Publikum an der FHNW einen faszinierenden Blick in die Zukunft der Kontaktlinse. Beim Vortrag «The Future of Contact Lens» begeisterte der international renommierte Forscher Prof. Lyndon Jones vom Centre for Ocular Research & Education (CORE) der University of Waterloo (Kanada) mit visionären Entwicklungen rund um die unscheinbare Linse im Auge.

Diese Veranstaltung wurde freundlicherweise von der Association des Optométristes Romands (AOR), Interlens, Organisation für Schweizer Optometrie (OSO), Mediconsult und Sensimed unterstützt.
Von der Sehkorrektur zur Therapie
Moderne Kontaktlinsen können heute weit mehr als Fehlsichtigkeiten ausgleichen: Sie erkennen Krankheiten, überwachen Körperfunktionen und verabreichen Medikamente gezielt über den Tränenfilm. Sogenannte „Drug-Delivery“-Kontaktlinsen ermöglichen die kontrollierte Freisetzung von Medikamenten über mehrere Stunden – ein grosser Fortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Augentropfen, die oft schon nach wenigen Minuten wieder ausgespült werden.
Auch neue diagnostische Anwendungen entstehen: Sensorhaltige Kontaktlinsen können den Augeninnendruck, die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit und sogar Biomarker für Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Alzheimer messen. Forschungsprojekte untersuchen, wie solche Linsen dazu beitragen könnten, systemische Erkrankungen frühzeitig und nichtinvasiv zu erkennen.
Smarte Linsen mit Energie aus Tränenflüssigkeit
Eine der verbleibenden Herausforderungen ist die Energieversorgung der Kontaktlinsen. Innovative Ansätze – etwa ultradünne Batterien, die Strom aus der chemischen Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit erzeugen – zeigen das Potenzial nachhaltiger Lösungen. Parallel dazu werden Bluetooth- und NFC-Technologien getestet, um Messdaten sicher von der Linse im Auge an Aufzeichnungsgeräte wie Smartphones zu übertragen.
«Wir stehen kurz davor, Kontaktlinsen zu erleben, die nicht nur das Sehen korrigieren, sondern auch messen, heilen und Informationen an die Trägerin oder den Träger weitergeben.» – Prof. Lyndon Jones.
3D-Druck, künstliche Intelligenz und Augmented Reality
Digitale Technologien beschleunigen die Innovation zusätzlich. Mithilfe des 3D-Drucks können Forschende individuell angepasste Kontaktlinsen herstellen, die exakt auf die Anatomie jedes einzelnen Auges zugeschnitten sind – einschliesslich solcher mit eingebetteten Medikamentenreservoirs oder optischen Elementen. Künstliche Intelligenz unterstützt bereits heute die Analyse von Tränenfilmbildern und die Diagnose von Erkrankungen wie dem «trockenen Auge».
Die Zukunft reicht jedoch noch weiter: Augmented-Reality-Kontaktlinsen könnten eines Tages Informationen direkt ins Sichtfeld projizieren – etwa für Navigation, Training oder medizinische Ausbildung.
Einfluss der Entwicklungen auf den Schweizer Linsenmarkt
In der anschliessenden Paneldiskussion mit Branchenexpertinnen und -experten Sarah Ven (AOR), Seonaid Collins (Optometriezentrum Basel), Daniel Ulrich (J&J Vision), Daniel Roos (Alcon) und Philippe Seira (FHNW) wurde die Bedeutung von Forschung, Ausbildung und Verantwortung in der Anwendung neuer Technologien hervorgehoben. «Die Kontaktlinse der Zukunft wird intelligenter, aber auch anspruchsvoller in der Anwendung. Innovation und Aufklärung müssen Hand in Hand gehen», betonte das Podium.

Blick nach vorn
Ob zur Behandlung von Augenkrankheiten, zur Messung von Gesundheitsdaten oder als Interface für Augmented Reality – die Zukunft der Kontaktlinse hat längst begonnen. Die Kombination aus Materialwissenschaft, Elektronik und künstlicher Intelligenz verspricht, das Sehen und die Augenheilkunde nachhaltig zu verändern.
Forschungsprojekte der FHNW
Assoziation zwischen Hornhautnervenfunktion, -morphologie und dem Trockenen Auge (DED) – https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ht/institute/forschungsprojekte/assoziation-zwischen-hornhautnervenfunktion-hornhautmorphologie-und-dem-trockenen-auge.